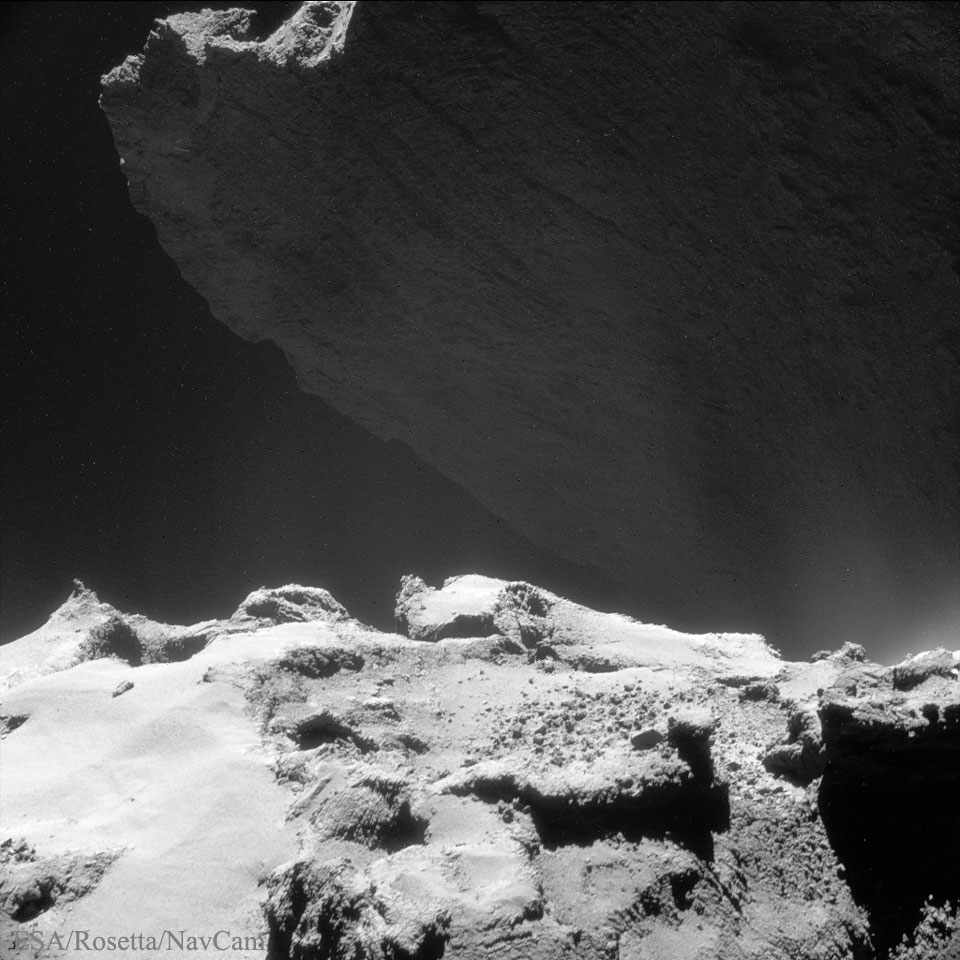Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, ESA, Venus Express: VIRTIS, USRA, LPI
Beschreibung: Sind die Vulkane auf der Venus noch aktiv? Wir kennen mehr Vulkane auf der Venus als auf der Erde, aber wann zum letzten Mal Vulkane auf der Venus ausgebrochen sind, ist nicht genau bekannt. Kürzlich wurde jedoch ein Hinweis auf sehr aktuellen Vulkanismus auf der Venus entdeckt, und zwar hier auf der Erde. Laborergebnisse zeigten, dass Infrarot-Bilder von Oberflächenlava in der dichten Venusatmosphäre im Laufe weniger Monate abklingen würden. Diese Abschwächung ist auf Bildern der ESA-Sonde Venus Express nicht zu beobachten.
Venus Express trat 2006 in eine Umlaufbahn um die Venus ein und hatte bis 2014 Kontakt mit der Erde. Daher ist das Infrarotleuchten (hier in Falschfarbenrot dargestellt), das Venus Express von Idunn Mons aufnahm, und das auf einem Bild der NASA-Sonde Magellan zu sehen ist, ein Hinweis, dass dieser Vulkan vor sehr kurzer Zeit ausgebrochen ist und heute immer noch aktiv ist. Der Vulkanismus auf der Venus könnte auch Erkenntnisse zum Vulkanismus auf der Erde und anderswo in unserem Sonnensystem liefern.
Neu: APOD ist nun auf Türkisch (Türkei) verfügbar
Zur Originalseite