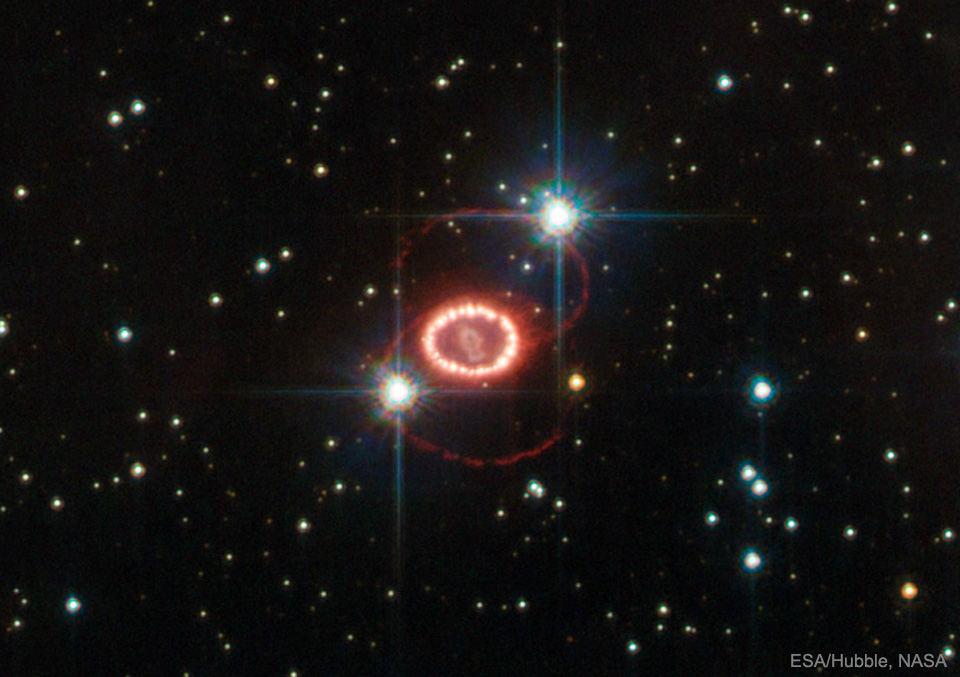Warum rotiert diese Galaxie so schnell? Es ist allein schon schwierig zu erkennen, zu welcher Art von Galaxien UGC 12591 gehört. Sie hat dunkle Staubbahnen wie eine Spiralgalaxie, aber eine große, diffuse Wölbung aus Sternen wie eine linsenförmige Galaxie. Wenn man sie beobachtet, zeigt sich, dass UGC 12591 überraschend schnell rotiert, nämlich mit etwa 480 km/s. Das ist fast doppelt so schnell wie die Rotation unsere Milchstraße. Es ist sogar die schnellste Rotation, die je gemessen wurde.
Damit eine Galaxie, die so schnell rotiert, nicht zerreißt, braucht sie die mehrfache Masse unserer Milchstraße. Ein mögliches Szenario zur Entstehung von UGC 12591 wäre ein langsames Wachstum, bei dem die Galaxie Materie aus der Umgebung ansammelte. Eine andere Möglichkeit wäre ein schnelles Wachstum durch eine oder mehrere Kollisionen von Galaxien in der jüngeren Vergangenheit. Vielleicht verraten künftige Beobachtungen mehr.
Das Licht, das wir heute sehen, verließ UGC 12591 vor etwa 400 Millionen Jahren. Damals entstanden gerade Bäume auf der Erde.