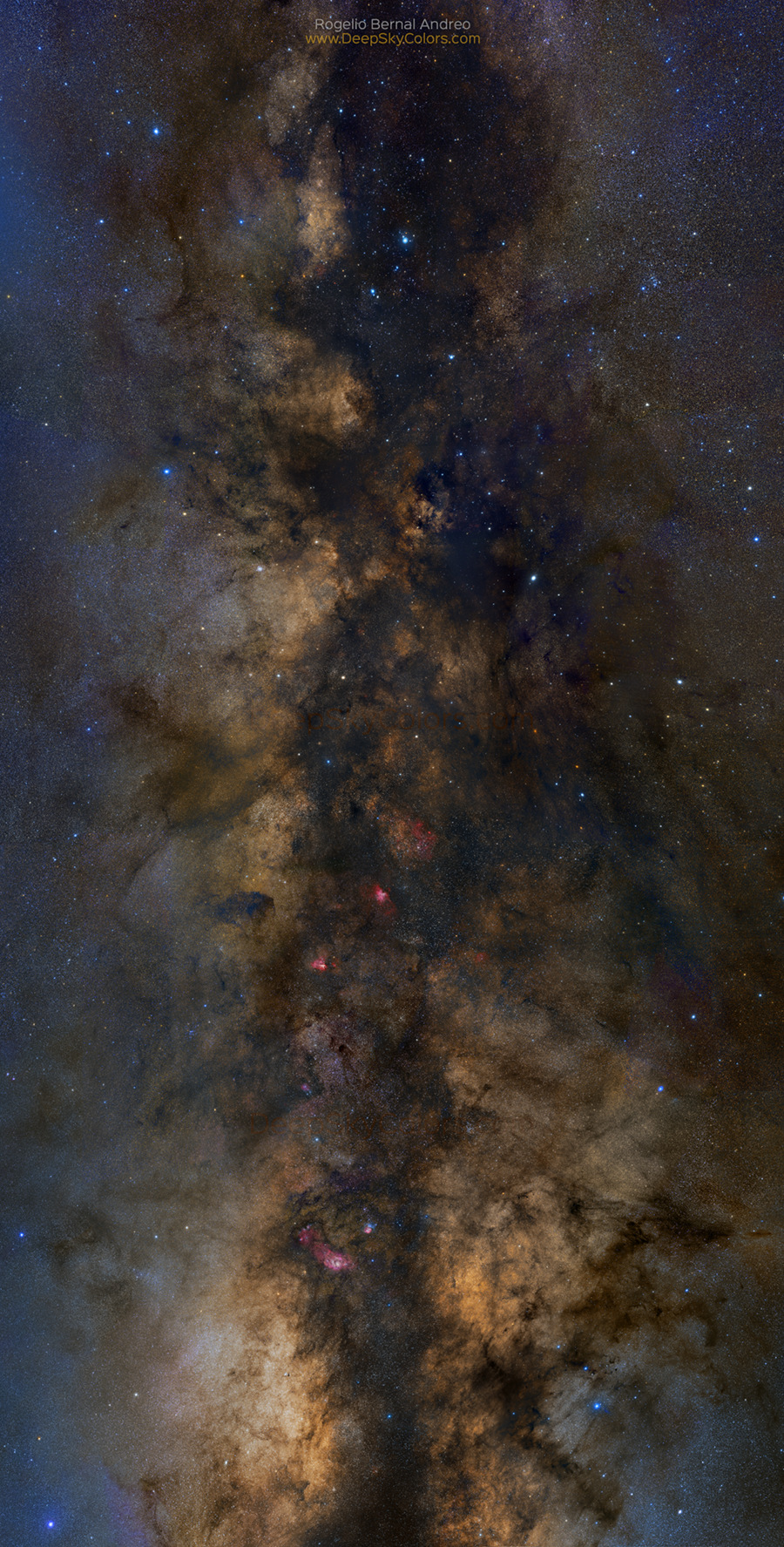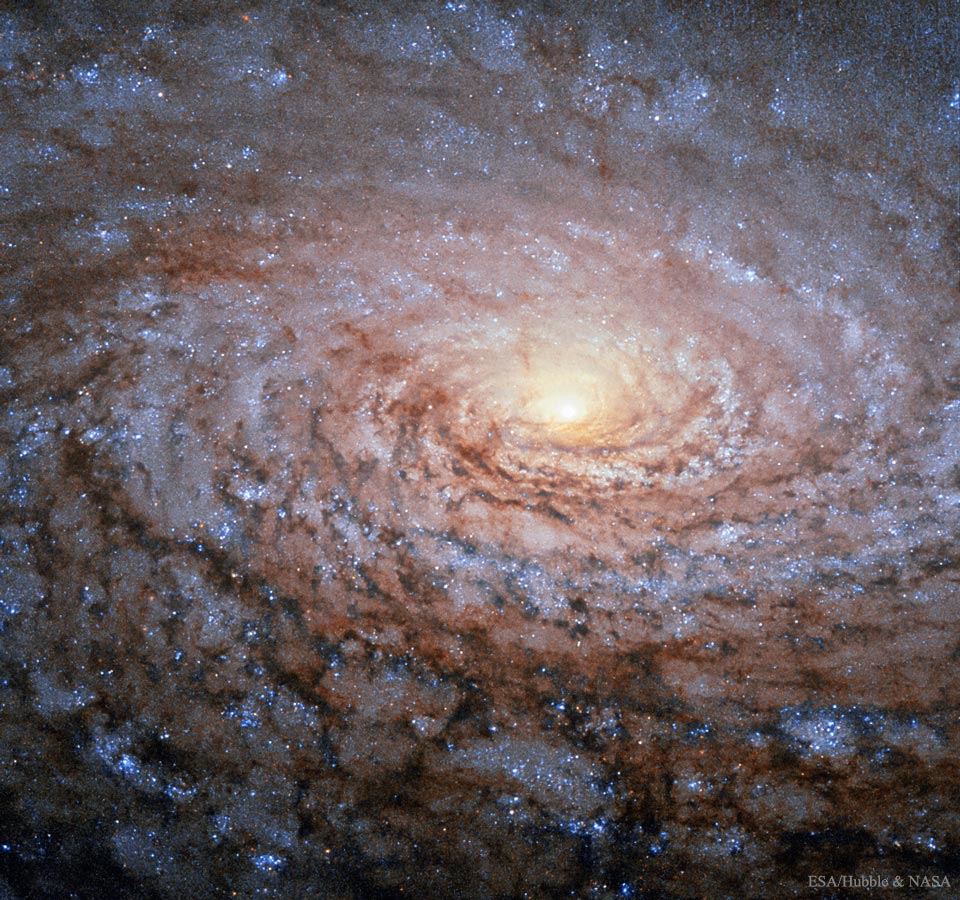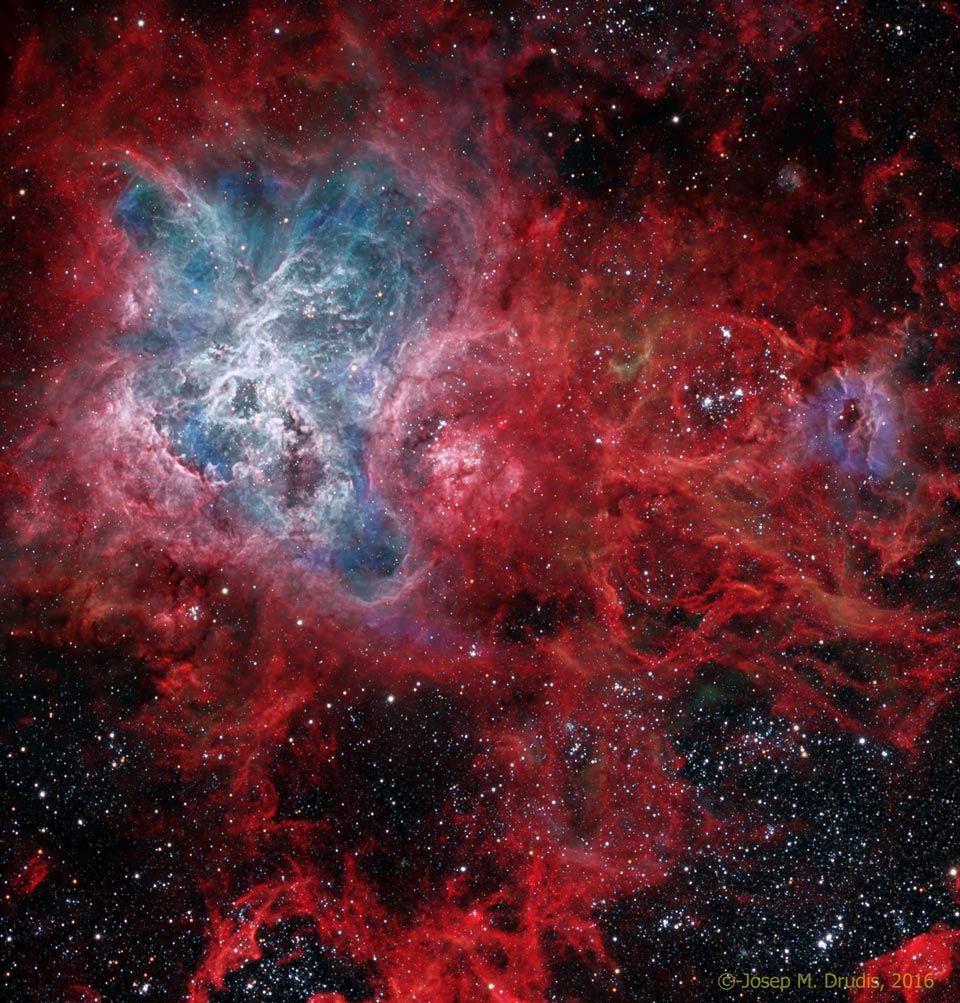Bildcredit und Bildrechte: Kris Smith
Was sind diese Flecken vor dem Mond? Es sind Silhouetten der Internationalen Raumstation ISS. Die Planung für das Bild war sekundengenau. Ein akribischer Mondfotograf fotografierte letzten Monat zehn Bilder der ISS, als sie vor dem Vollmond vorbeizog. Doch es war nicht irgendein Vollmond. Es war der erste der drei Supermonde 2016 in Serie.
Ein Supermond ist ein Vollmond, der ein paar Prozent größer und heller ist als andere Vollmonde. Diese Bildfolge entstand bei Dallas in Texas. Heute sehen wir den zweiten Supermond dieser Serie. Dieser Vollmond ist nicht nur der größte und hellste des Jahres, sondern jedes Jahres seit 1948. Um den Super-Supermond zu sehen, geht einfach nachts hinaus und seht nach oben. Der dritte Supermond der Serie folgt Mitte Dezember.