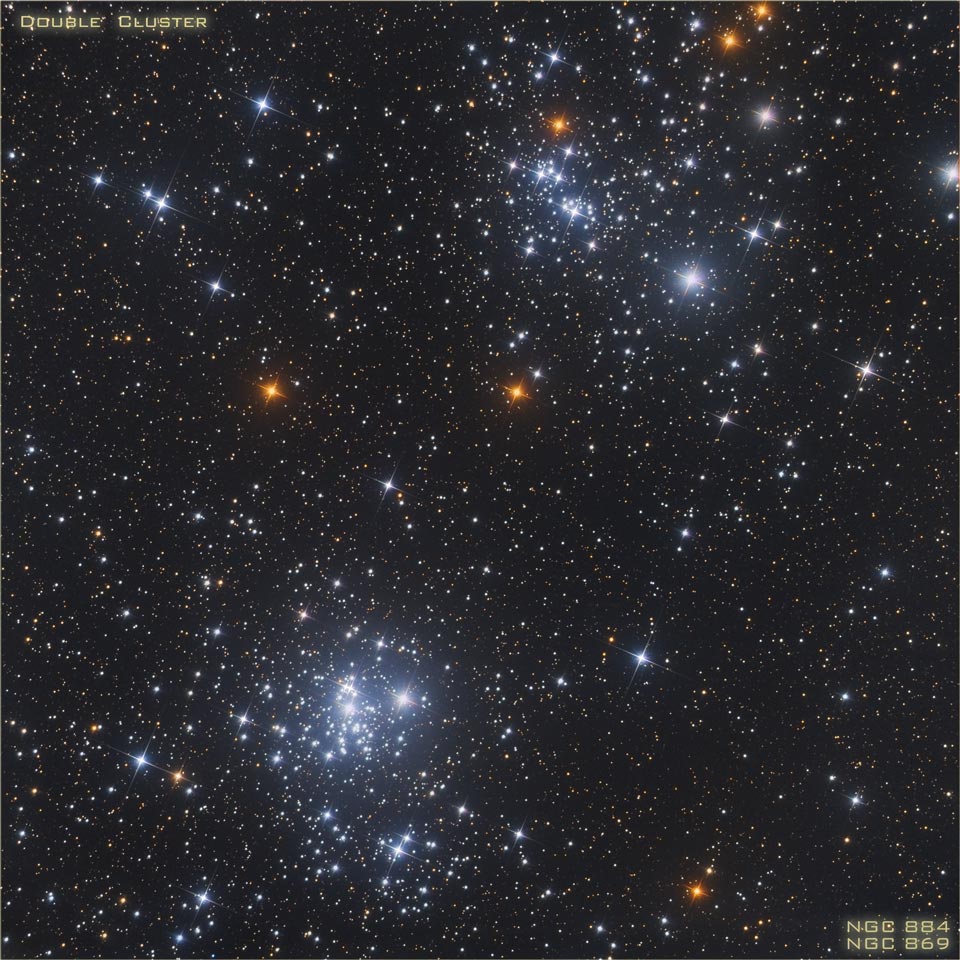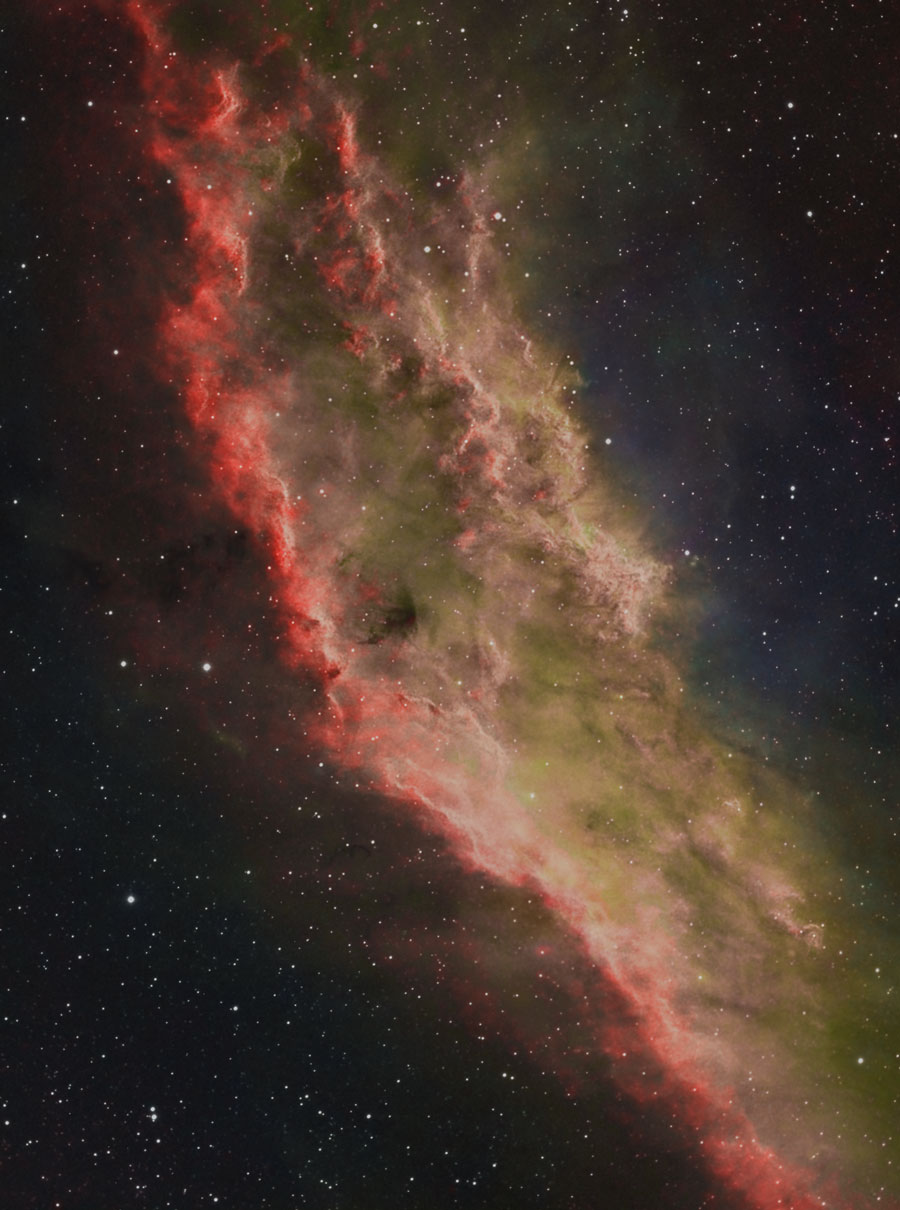Bildcredit und Bildrechte: Babak Tafreshi (TWAN)
Auf dieser Nachthimmelslandschaft vom 7. August blitzten zwei helle Meteore auf. Sie waren Teil des aktuellen Meteorstroms der Perseïden. Die beiden farbigen Streifen zeigen zum Radiant des Meteorstroms rechts oben. Er liegt im namensgebenden Sternbild Perseus.
Der Nordstern Polaris steht oben links in der Mitte der kurzen, gebogenen Strichspuren. Das Kloster im Vordergrund ist Teil von Meteora. Es wurde auf gewaltigen Sandsteinklippen errichtet und wurde unter anderem wegen seiner Position vor dem Himmel benannt. Das UNESCO-Welterbe Meteora ist ein historischer Komplex von Klöstern in der Nähe von Kalabaka in Zentralgriechenland, die in der Höhe erbaut wurden.