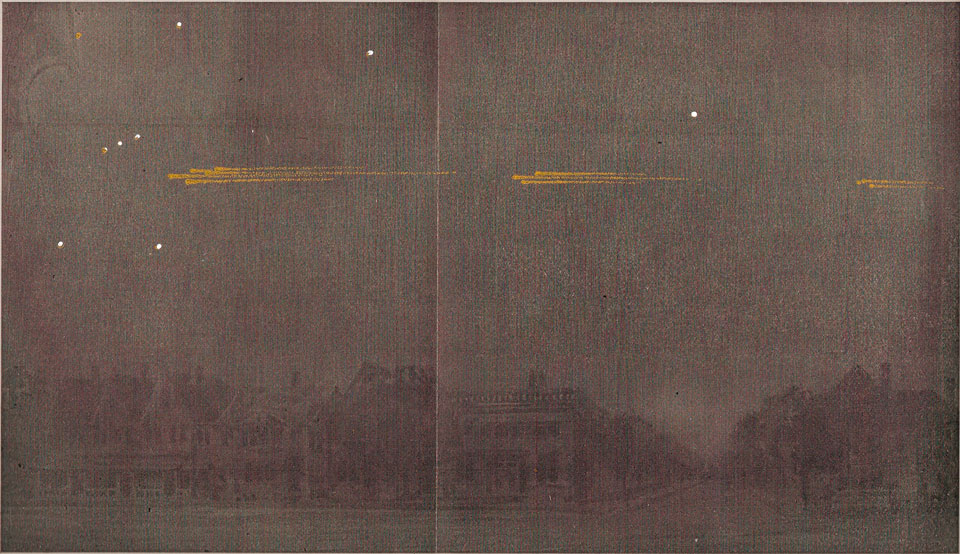Bildaufbau und Bearbeitung: Robert Gendler; Bilddaten: ESO, VISTA, HLA, Hubble-Vermächtnisteam (STScI/AURA)
Bilddaten vom wuchtigen erdgebundenen VISTA-Teleskop und dem Weltraumteleskop Hubble wurden zu einer interstellaren Landschaft mit Weitwinkelperspektive kombiniert. Sie umgibt den berühmten Pferdekopfnebel. Die staubhaltigen Molekülwolken wurden im nahen Infrarot fotografiert.
Die Szenerie bedeckt am Himmel einen Winkel von etwa zwei Dritteln des Vollmondes. In der Entfernung des Pferdekopfnebels von etwa 1600 Lichtjahren ist das Bild etwas mehr als 10 Lichtjahre breit. Der immer noch erkennbare Pferdekopfnebel rechts oben ist auch als Barnard 33 bekannt. Die Staubsäule leuchtet im nahen Infrarot und ist von neuen Sternen gekrönt.
Der helle Reflexionsnebel NGC 2023 links unten ist die beleuchtete Umgebung eines heißen, jungen Sterns. Dichte Wolken am Fundament des Pferdekopfes und an den Rändern von NGC 2023 zeigen verräterische rote Emission energiereicher Strahlströme. Es sind sogenannte Herbig-Haro-Objekte, auch sie stehen in Verbindung mit neu entstanden Sternen.