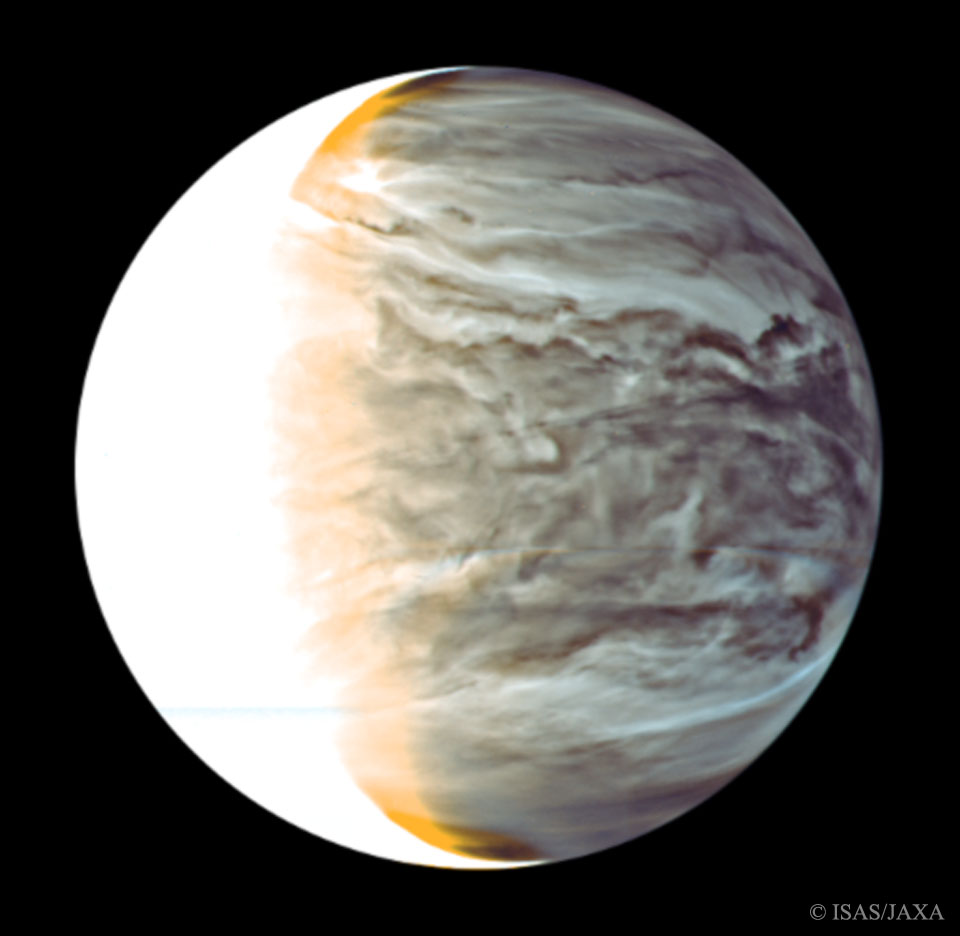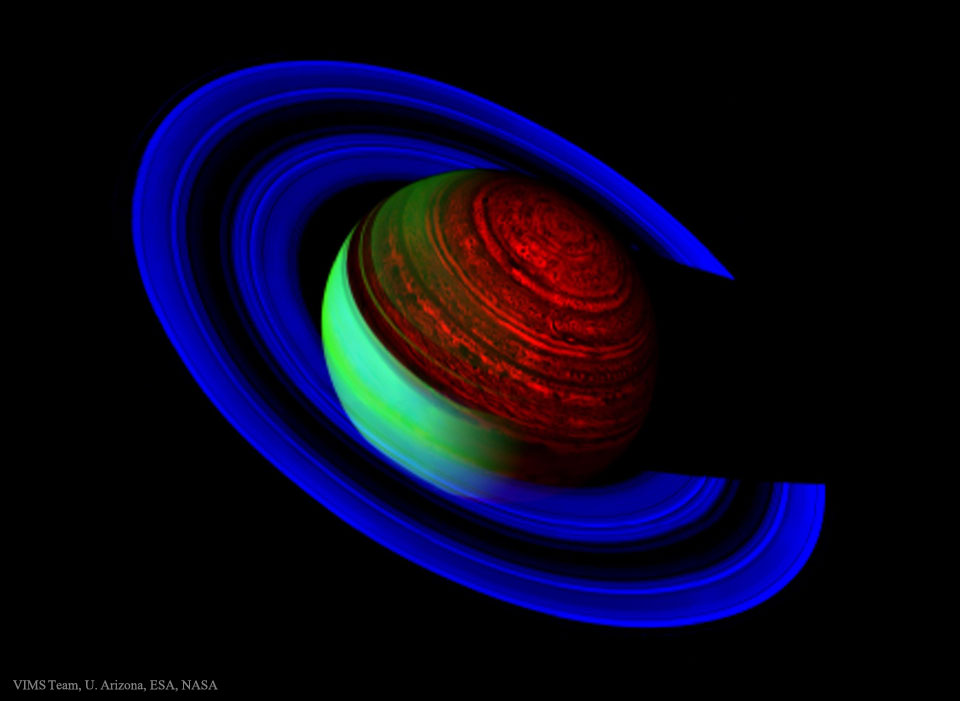Bildcredit: ESO, VLT, HAWK-I, H. Drass et al.
Dieses detailreiche Bild zeigt den Orionnebel in Infrarot. Darin liegt eine Goldgrube an Sternen mit geringer Masse, die man zuvor nicht kannte. Dazu kommen – möglicherweise – frei schwebende Planeten.
Der malerische Nebel ist in sichtbarem Licht sehr bekannt. Er enthält so manche hellen Sterne und hell leuchtendes Gas. Der Orionnebel ist als M42 katalogisiert. Er ist 1300 Lichtjahre entfernt. Somit ist er die erdnächste große Region, in der Sterne entstehen. Im Licht von Infrarot kann man in Orions dichten Staub hineinspähen. Das geschah kürzlich wieder mit der komplexen Kamera HAWK-I. Sie ist an die VLT-Einheit Yepun der Europäischen Südsternwarte ESO montiert. Das Observatorium steht in den chilenischen Bergen.
Hoch aufgelöste Versionen des Infrarotbildes zeigen zahllose Lichtpunkte. Viele davon sind sicherlich braune Zwergsterne. Aber manche passen am besten zu frei schwebenden Planeten. Es sind sogar unerwartet viele. Es ist wichtig, herauszufinden, wie diese Objekte mit geringer Masse entstanden sind, wenn man Sternbildung allgemein verstehen will. Das hilft uns vielleicht, die frühen Jahre unseres Sonnensystems besser zu erklären.
Überarbeitete Version: neu gefärbt mit mehr Details.