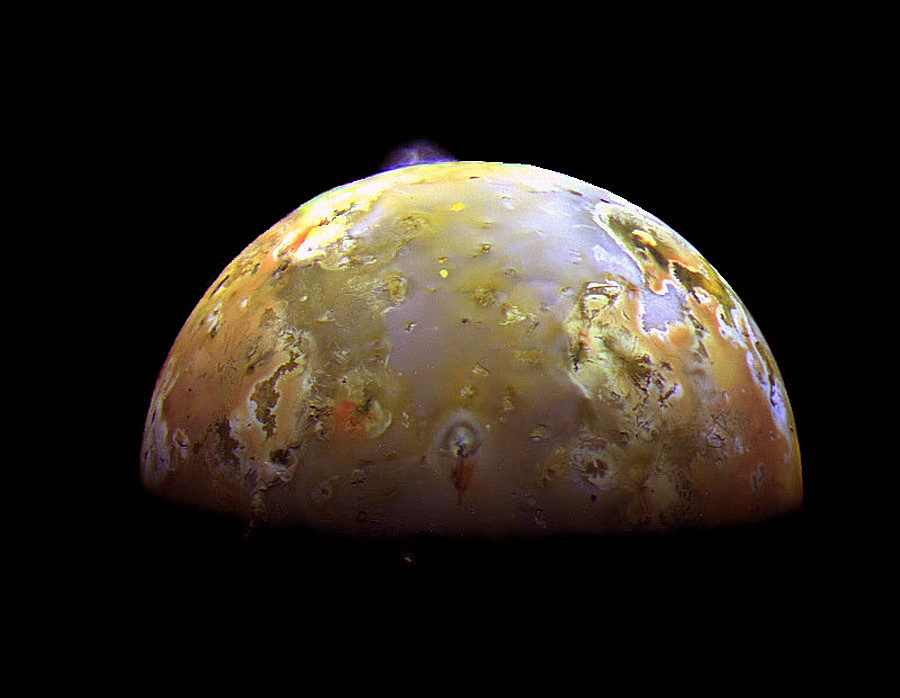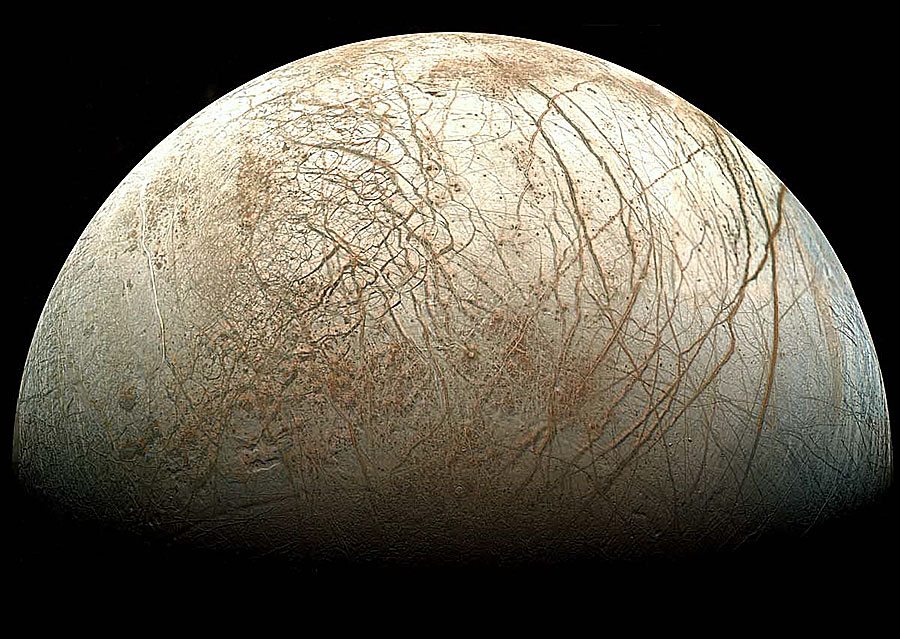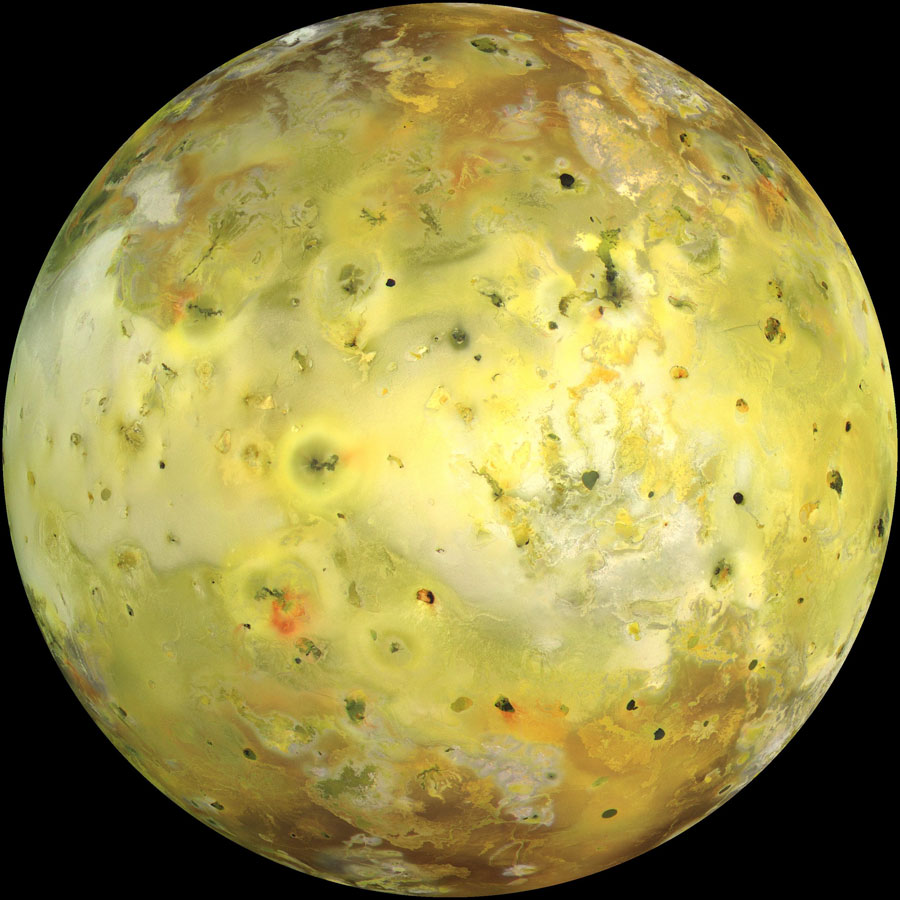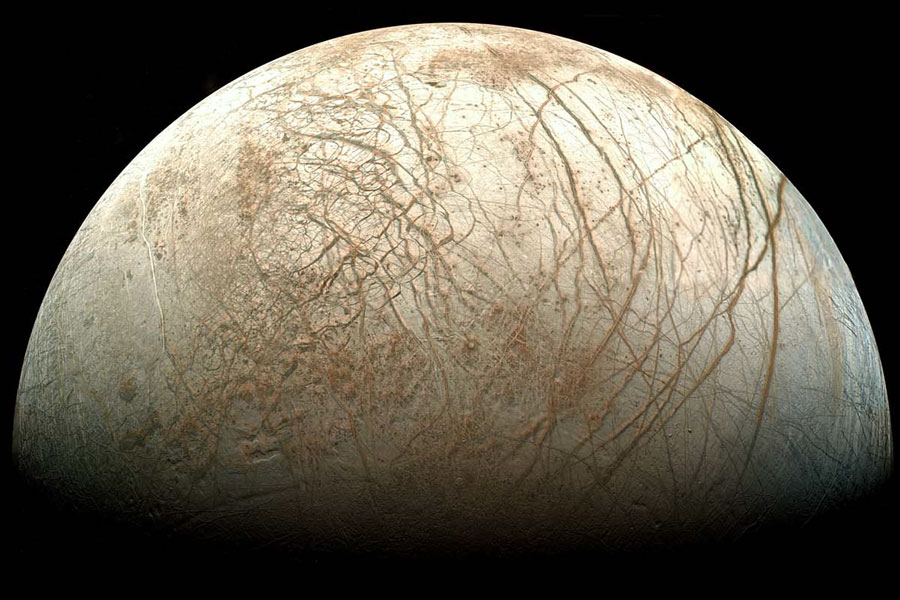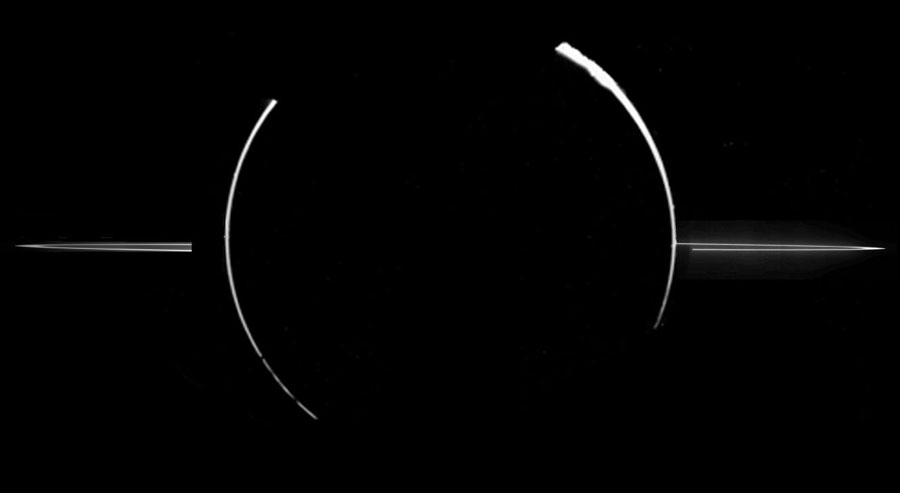Bildcredit: Apollo 15-Besatzung, NASA
Wenn ihr einen Hammer und eine Feder gleichzeitig fallen lasst, was erreicht zuerst den Boden? Auf der Erde der Hammer. Doch ist der Grund dafür nur der Luftwiderstand?
Schon vor Galileo überlegten Forschende und führten einfache Experimente durch. Sie meinten, dass ohne Luftwiderstand alle Objekte gleich fallen müssten. Galileo testete dieses Prinzip und fand heraus, dass zwei schwere Bälle mit unterschiedlicher Masse gleichzeitig den Boden erreichen. Historiker bezweifeln, dass Galileo dieses Experiment im Schiefen Turm von Pisa in Italien durchführte, wie der Volksmund berichtet.
Ein gut geeigneter Ort, wo man das Äquivalenzprinzip ohne Luftwiderstand testen kann, ist der Erdmond. Daher ließ der Apollo-15-Astronaut David Scott 1971 einen Hammer und eine Feder gleichzeitig auf den Mondboden fallen. Tatsächlich erreichten Hammer und Feder gleichzeitig den Mondboden, genau wie Galileo, Einstein und andere vorhergesagt hatten.
Das hier demonstrierte Äquivalenzprinzip besagt, dass die Beschleunigung eines Objekts durch die Gravitation nicht von seiner Masse, Dichte, Zusammensetzung, Farbe, Form oder Ähnlichem abhängt. Das Äquivalenzprinzip ist in der modernen Physik so wichtig, dass seine Auswirkung noch heute untersucht wird.