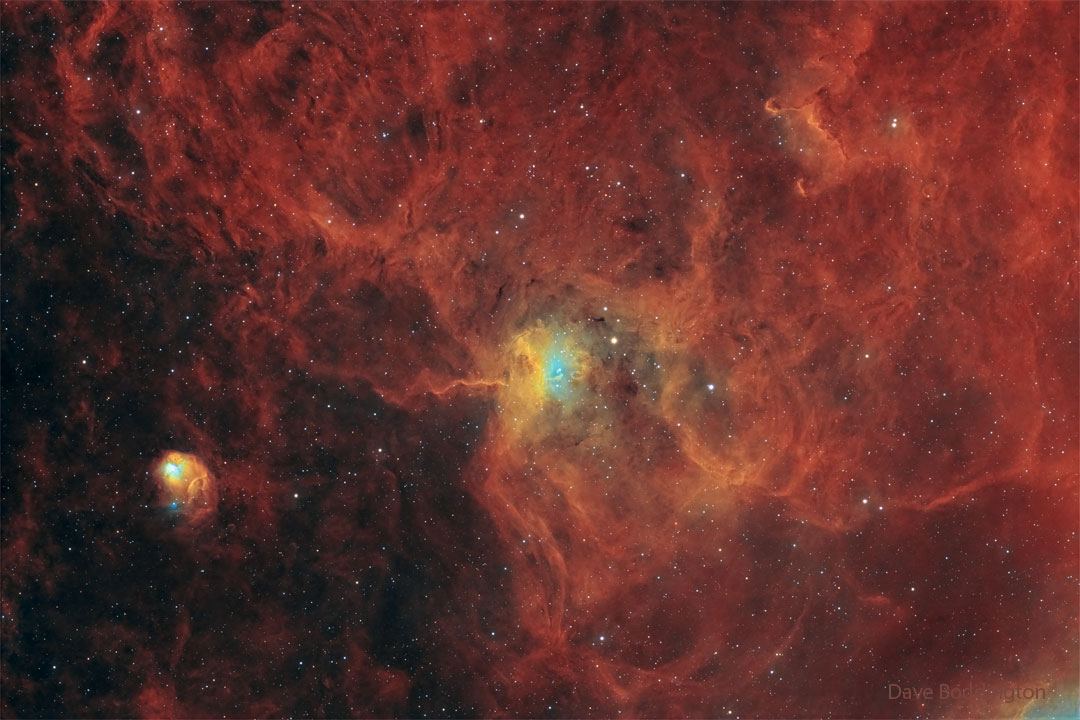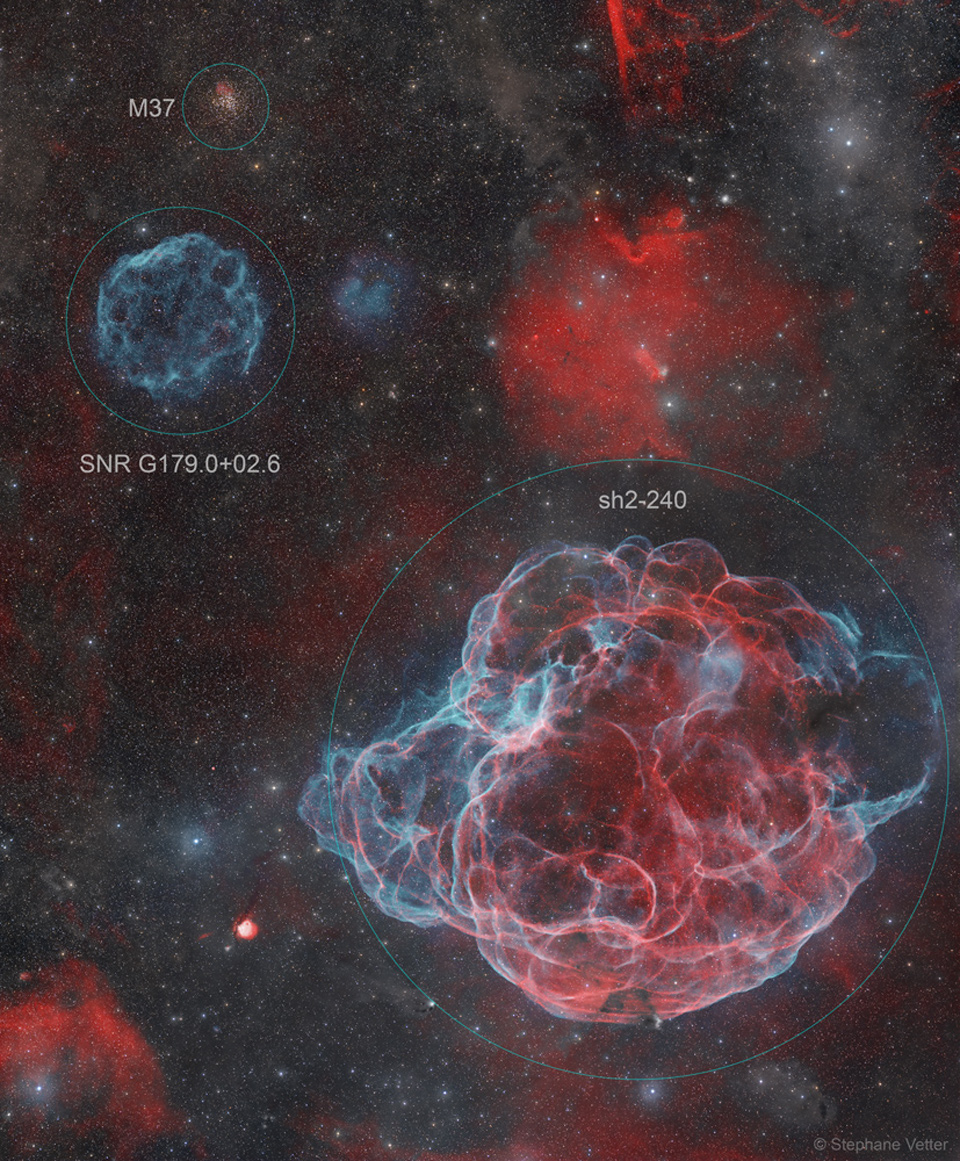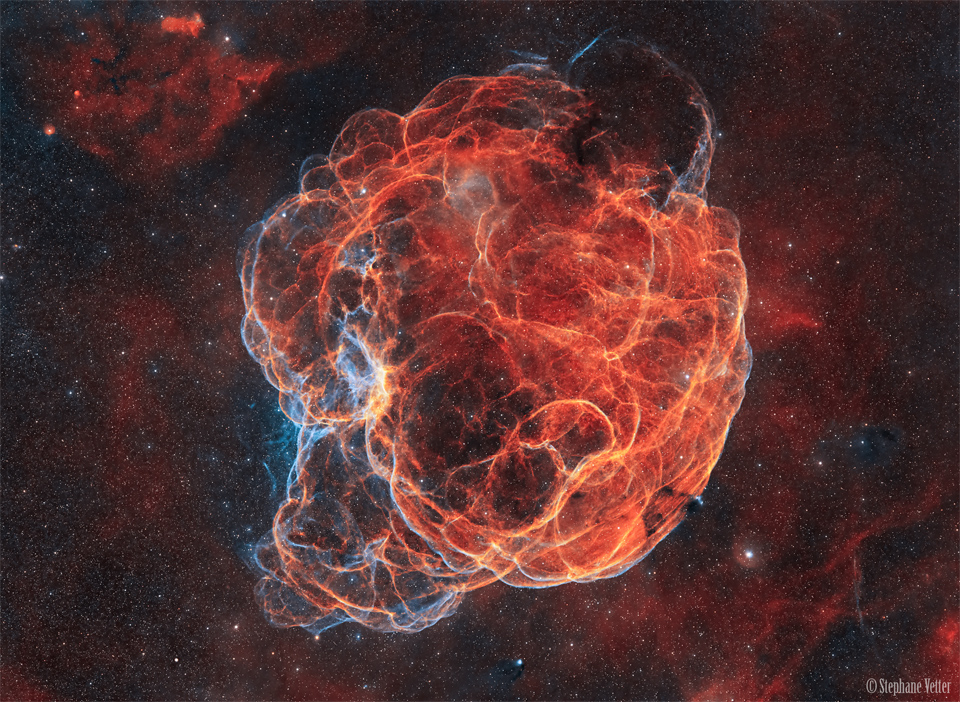Bildcredit und Bildrechte: Roberto Marinoni
Der schöne, blaue VdB 31 im Sternbild Auriga ist das 31. Objekt in Sidney van den Berghs Katalog der Reflexionsnebel, der 1966 erschien. VdB 31 teilt dieses gut komponierte Himmelsstillleben mit den dunklen, undurchsichtigen Wolken B26, B27 und B28. Sie sind in Edward E. Barnards Katalog der dunklen Markierungen am Himmel aus dem Jahr 1919 aufgeführt.
Bei allen handelt es sich um interstellare Staubwolken. Im Falle der Barnard’schen Dunkelnebel blockieren sie das Licht der Hintergrundsterne. Bei VdB 31 reflektiert der Staub vorzugsweise das bläuliche Sternenlicht des eingebetteten, heißen, veränderlichen Sterns AB Aurigae.
Die Erforschung der Umgebung von AB Aurigae mit dem Hubble-Weltraumteleskop hat ergeben, dass der mehrere Millionen Jahre junge Stern selbst von einer abgeflachten Staubscheibe umgeben ist. Sie enthält Hinweise auf die laufende Bildung eines Planetensystems. AB Aurigae ist etwa 470 Lichtjahre entfernt. Bei dieser Entfernung würde sich diese kosmische Leinwand über etwa acht Lichtjahre erstrecken.