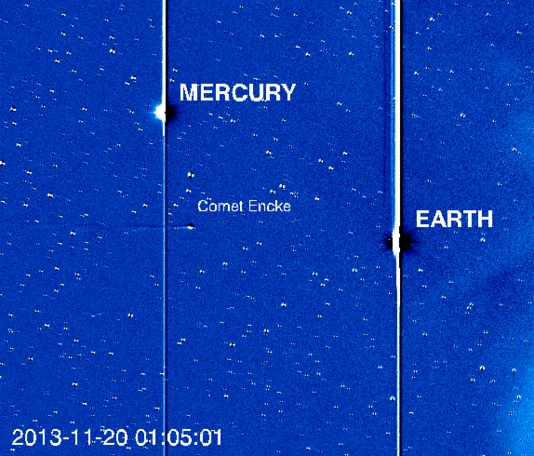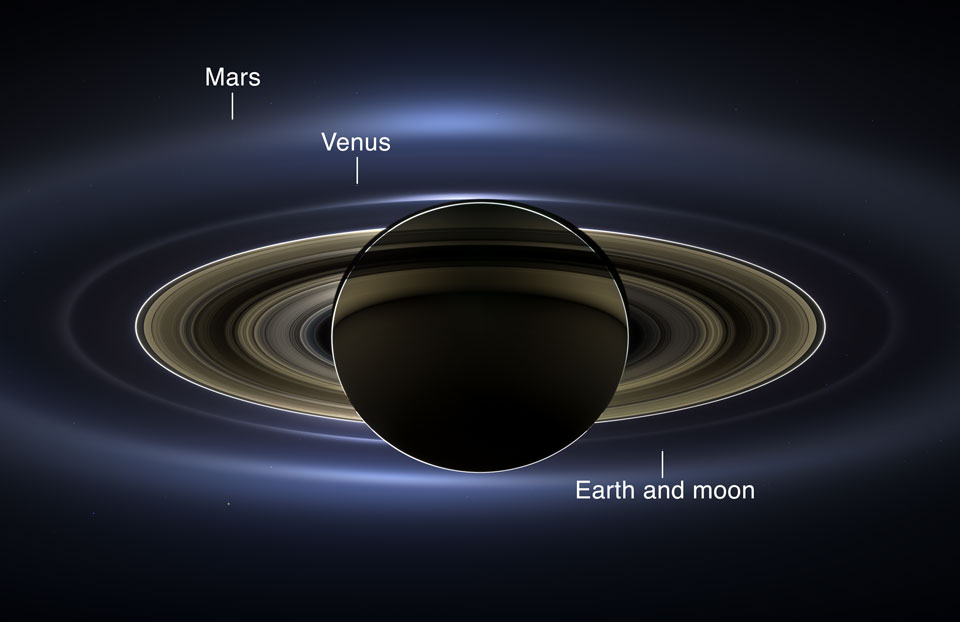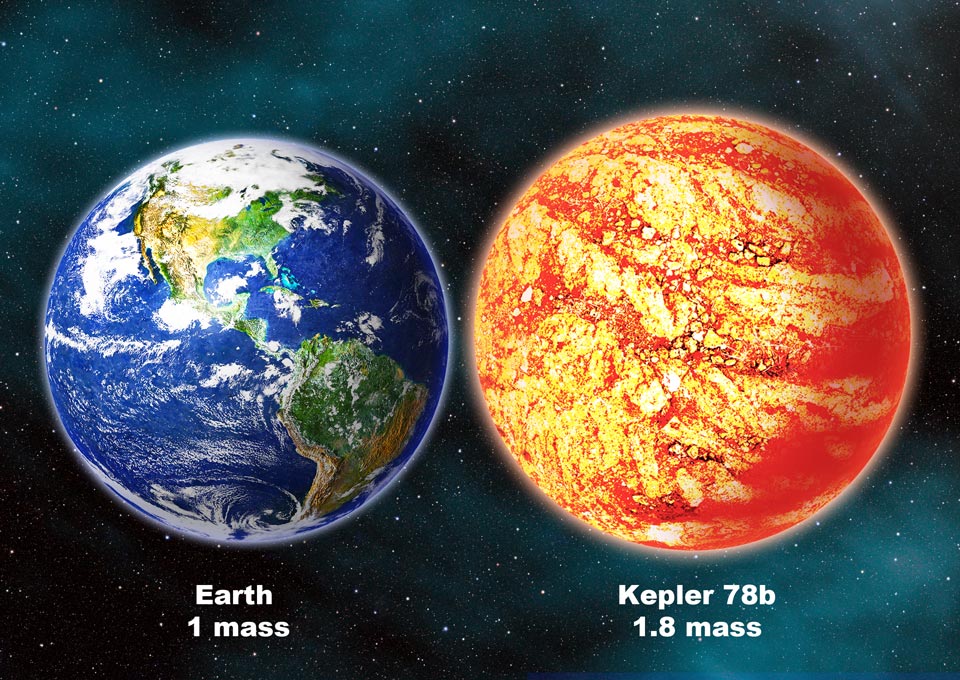Videocredit und -rechte: Red Bull Stratos, GoPro; Musik: Wilderness is Their Home Now und Satellites (East of the River), ExtremeMusic
Wie fühlt es sich an, wenn man aus großer Höhe zur Erde fällt? 2012 stellte Felix Baumgartner einen neuen Rekord für den höchsten Sprung auf. Er brach damit den früheren Sturzflug-Rekord von 31,3 Kilometern. Baumgartner sprang bei einem kommerziell organisierten Projekt von einer Ballonplattform, die 39 Kilometer über New Mexico in den USA schwebte. Er zeichnete den ganzen Sturz auf Video auf.
Baumgartner trug einen Druckanzug, der ihn mit atembarer Luft und Wärme versorgte, während er im Ballon aufstieg. Später kühlte er ihn, als beim Sturz Reibungshitze entstand. Im freien Fall stürzte Baumgartner 36,4 Kilometer tief, ehe er seinen Fallschirm öffnete. Er erreichte dabei eine Geschwindigkeit von über 1000 Kilometern pro Stunde und durchbrach die Schallmauer.
Dieses Video zeigt seinen freien Fall in Echtzeit. Er dauerte vier Minuten und 19 Sekunden. Bei dem waghalsigen Kunststück trat in der zweiten Minute eine etwas unerwartete, potenziell gefährliche Rotation auf. Sie hätte Baumgartner bewusstlos machen oder ihn zumindest desorientieren können. Nach dem packenden Sturz öffnete Baumgartner die Fallschirme und landete sicher.