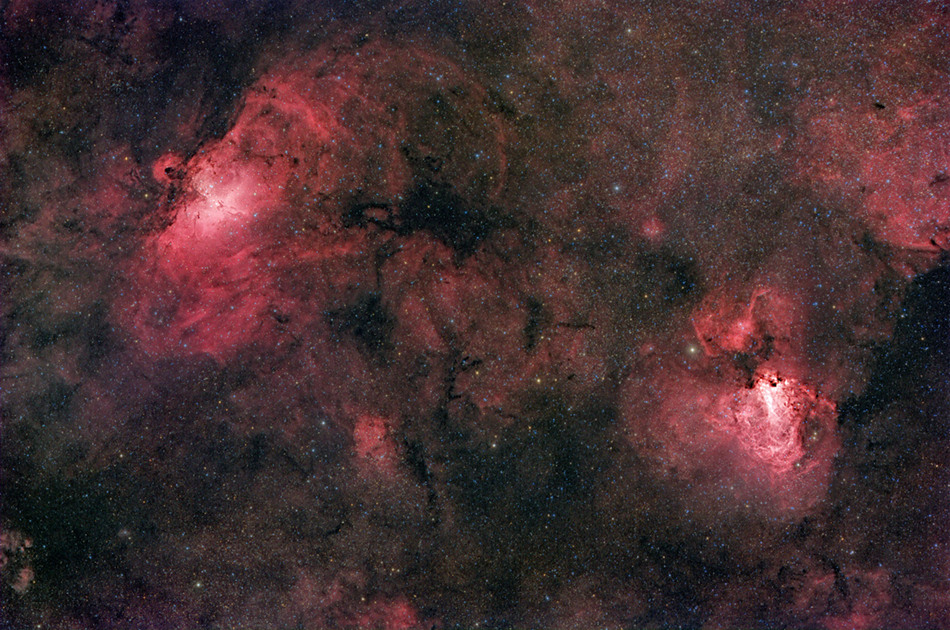Bildcredit: NASA, ESA und Hubble-Vermächtnis (STScI / AURA)- ESA / Hubble-Arbeitsgemeinschaft
Nach den Saturnringen ist der Ringnebel (M57) in der Leier der vielleicht berühmteste Himmelskreis. Seine klassische Erscheinung ist nach heutigem Verständnis der Perspektive geschuldet.
Die neueste Kartierung der wachsenden 3-D-Struktur im Nebel basiert zum Teil auf diesem klaren Hubblebild. Sie lässt vermuten, dass der Nebel ein relativ dichter, krapfenähnlicher Ring ist. Um die Mitte ist er in eine Wolke aus leuchtendem Gas gehüllt. Sie hat die Form eines Footballs. Von der Erde aus blickt man die Längsachse des Footballs entlang. Der Blick fällt von oben auf den Ring.
Die leuchtende Materie dieses gut untersuchten planetarischen Nebels stammt nicht von Planeten, sondern die gasförmige Hülle besteht aus den abgestoßenen äußeren Schichten eines vergehenden sonnenähnlichen Sterns. Es ist der winzige Nadelstich aus Licht in der Mitte des Nebels.
Das intensive Ultraviolettlicht des heißen Zentralsterns ionisiert die Atome im Gas. Die blaue Farbe in der Bildmitte stammt von ionisiertem Helium. Der Farbton Cyan am inneren Ringrand ist das Licht von angeregtem Wasserstoff und Sauerstoff. Die rötliche Farbe des äußeren Rings stammt von Stickstoff und Schwefel.
Der Ringnebel ist etwa ein Lichtjahr groß und 2000 Lichtjahre entfernt.