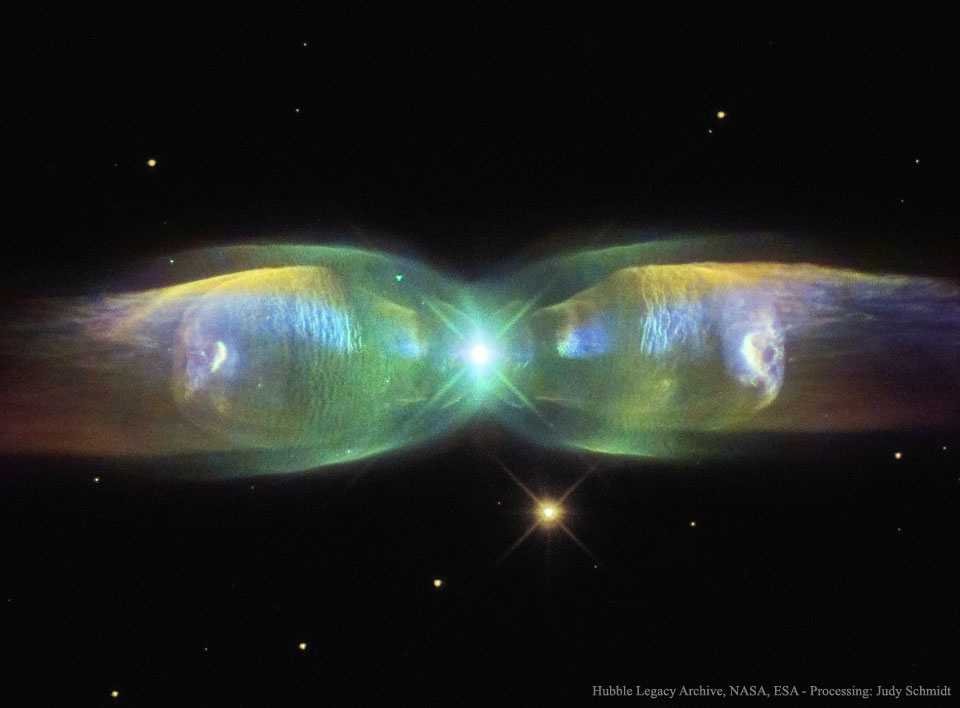Bildcredit und Bildrechte: Roger N. Clark
Was macht dieser Meteor? Dynamisch gesehen ist die asymmetrische Bahn untypisch kurz. Der Pfad verläuft leicht spiralförmig. Das ist ein Hinweis, dass das Sandkörnchen mitten im Aufleuchten einen Augenblick lang rotiert, während es verdampft. Geografisch trifft der Meteor scheinbar den Herznebel. In Wirklichkeit verglüht er in der Erdatmosphäre. Er ist also etwa eine Quadrillion Mal näher.
Der Meteor wurde letzten Monat in der Nacht fotografiert, als die Perseïden den Höhepunkt erreichten. Er gehört wahrscheinlich zu diesem Meteorstrom. Der Radiant der Perseïden liegt im Sternbild Perseus, das rechts oben außerhalb des Bildes liegt. Dorthin zeigt der Meteorpfeil.
Der Herznebel wurde auf 18 Aufnahmen fotografiert, die je 1 min belichtet sind. Der ungewöhnliche Meteorpfeil war auf nur einer Aufnahme zu sehen. Die Meteorbahn leuchtet in mehreren Farben, diese werden von verschiedenen Elementen im aufgeheizten Gas abgestrahlt.