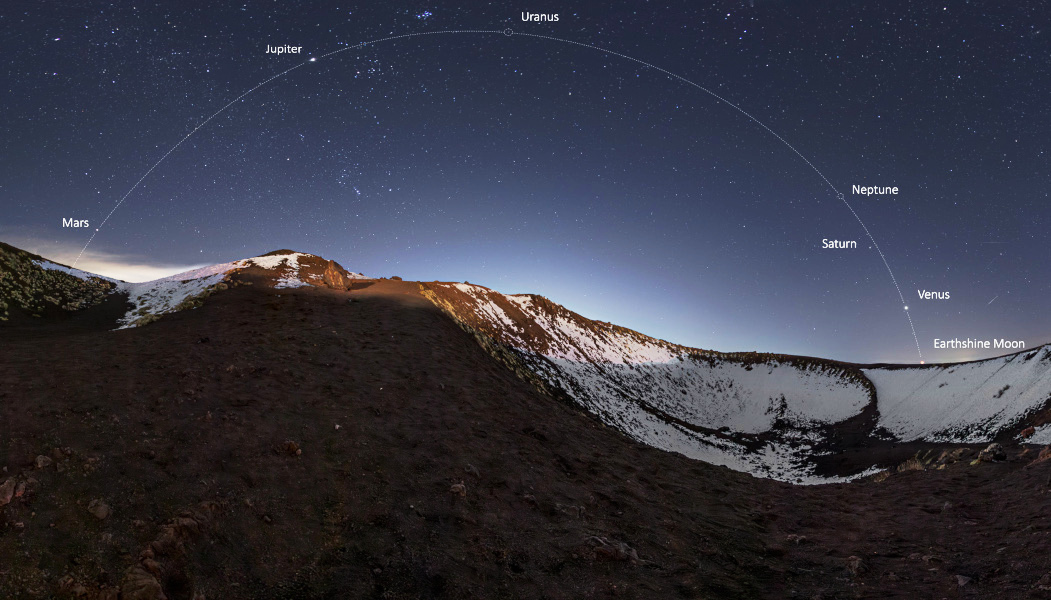Bildcredit und Bildrechte: Aldo S. Kleiman
Diese Aufnahme aus Rosario in Argentinien entstand in der Dämmerung. Sie zeigt die enge Konjunktion der beiden hellsten Himmelsobjekte, die am 1. Februar im Westen am Abendhimmel des Planeten Erde zu sehen waren. Das Bild wurde mit einem Teleobjektiv aufgenommen und zeigt die zunehmende Mondsichel und die abnehmende Venussichel in den gegenüberliegenden Ecken.
Zum Aufnahmezeitpunkt war der zunehmende Mond etwa drei Tage alt. Die von der Sonne beleuchtete schmale Mondsichel wird bis zum 14. Februar zu einem hellen Vollmond heranwachsen.
Wie der Mond zeigt auch die Venus wechselnde Phasen, während sie die Sonne umläuft. Von der Erde aus gesehen, wird die von der Sonne beschienene Sichel dieses inneren Planeten schmaler, während die scheinbare Größe weiter zunimmt, wenn die Venus sich uns nähert.
Als Valentinsgruß aus dem Sonnensystem wird die Venus, die nach der römischen Göttin der Liebe benannt ist, am Abendhimmel der Erde um den 14. Februar herum außerdem ihre größte Helligkeit erreichen.