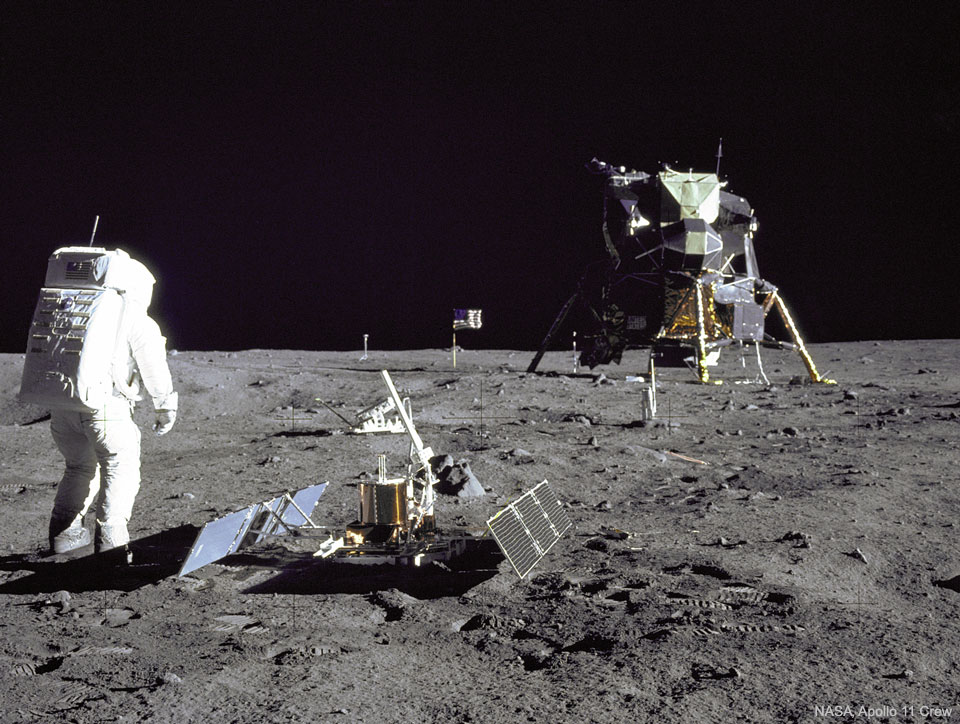Bildcredit und Bildrechte: Daniel Yang K.
In einem Garten auf der Erde entstand nach 38 Stunden Belichtungszeit mit Kamera und einem kleinen Teleskop dieses kosmische Foto. Es zeigt die Galaxiengruppe M81. Die Hauptgalaxie der Gruppe ist M81 in der Mitte. Sie hat prachtvolle Spiralarme und einen hellen, gelben Kern. M81 ist auch als Bodes Galaxie bekannt. Sie ist ungefähr 100.000 Lichtjahre breit.
Oben ist die zigarrenförmige, irreguläre Galaxie M82. Das Paar ist seit Milliarden Jahren in einen Gravitationskampf verwickelt. Die Anziehung jeder Galaxie hat die jeweils andere bei einer Serie kosmischer naher Begegnungen stark verändert. Ihre letzte Annäherung dauerte etwa 100 Millionen Jahre. Wahrscheinlich entstanden dabei die Dichtewellen um M81. Sie führten zu heftiger Sternbildung an den Spiralarmen von M81.
Auch M82 weist gewaltige Sternbildungsregionen und kollidierenden Gaswolken auf. Sie sind so energiereich, dass die Galaxie in Röntgenlicht leuchtet. In den nächsten Milliarden Jahren führen ihre fortwährenden gravitativen Begegnungen dazu, dass die beiden Galaxien verschmelzen. Dann bleibt eine einzige Galaxie übrig.
Links unter der großen Spirale M81 ist ein weiteres Mitglied der Gruppe, nämlich NGC 3077. Die M81-Galaxiengruppe ist sehr weit entfernt – ganze 12 Millionen Lichtjahre. Sie befindet sich im nördlichen Sternbild Großer Bär (Ursa Major). Näher bei uns ist das Weitwinkelfeld von Integrierten Flussnebeln gefüllt. Diese blassen, staubigen interstellaren Wolken schweben über der Ebene der Galaxis und reflektieren das Licht ihrer Sterne.