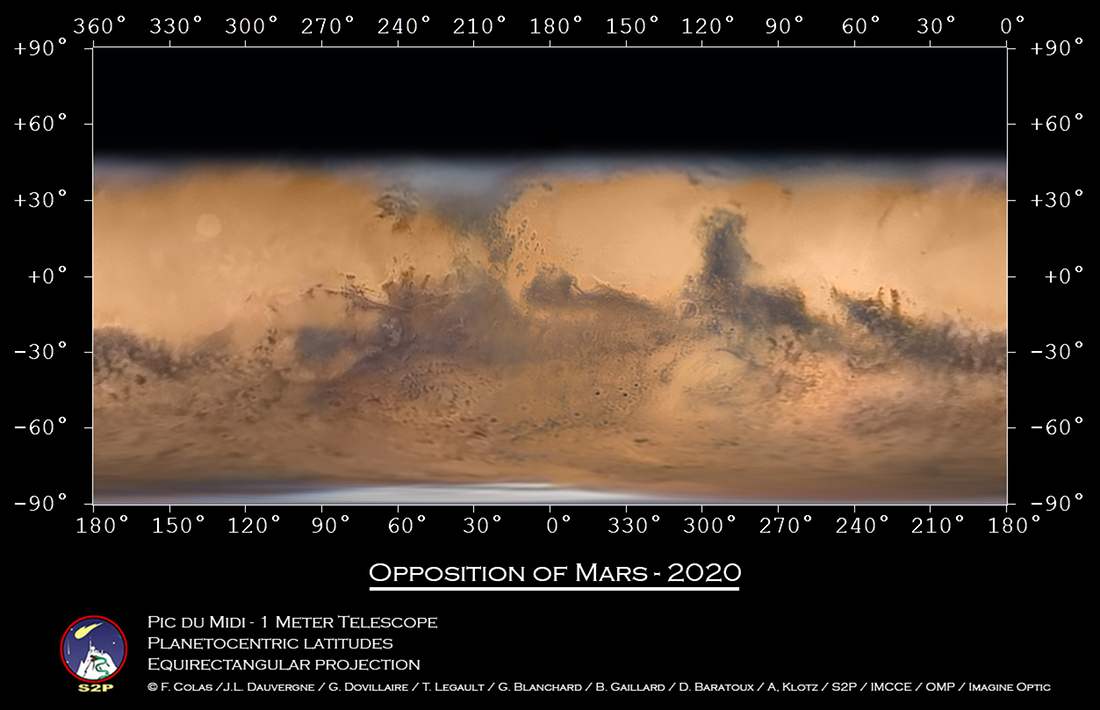Illustrationscredit und Bildrechte: Eric Coles
Beschreibung: Der große Truthahnnebel, der dieses kreative Bild ausfüllt, sieht dem großen Orionnebel überraschend ähnlich. Wäre es der Orionnebel, dann wäre er natürlich unser nächstliegendes großes Sternentstehungsgebiet am Rand einer großen Molekülwolke, die etwa 1500 Lichtjahre entfernt ist.
Der Orionnebel ist auch als M42 bekannt, ihr seht ihn mit bloßem Auge als mittleren „Stern“ im Schwert des Jägers Orion. Dieses Sternbild geht derzeit am Abendhimmel des Planeten Erde auf. Die Sternwinde der Haufen neu entstandener Sterne, die überall im Orionnebel verteilt sind, formen seine Ränder und Höhlungen, die uns von Teleskopbildern her vertraut sind.
Dieser große, frei erfundene Truthahnnebel ist ähnlich groß wie der Orionnebel mit einem Durchmesser von ungefähr 13 Lichtjahren. Bleibt vorsichtig und gesund!