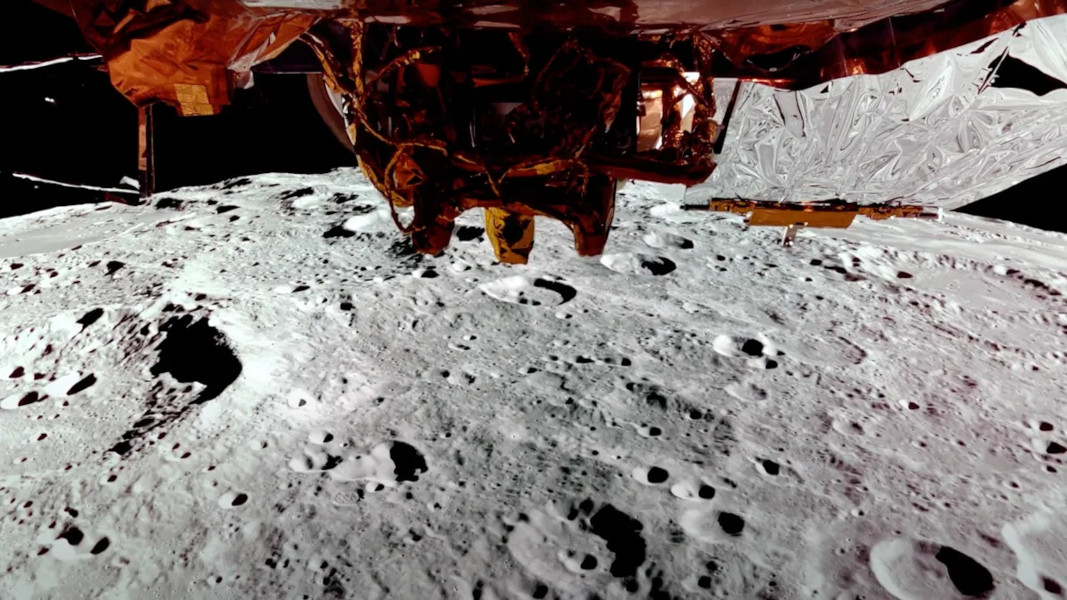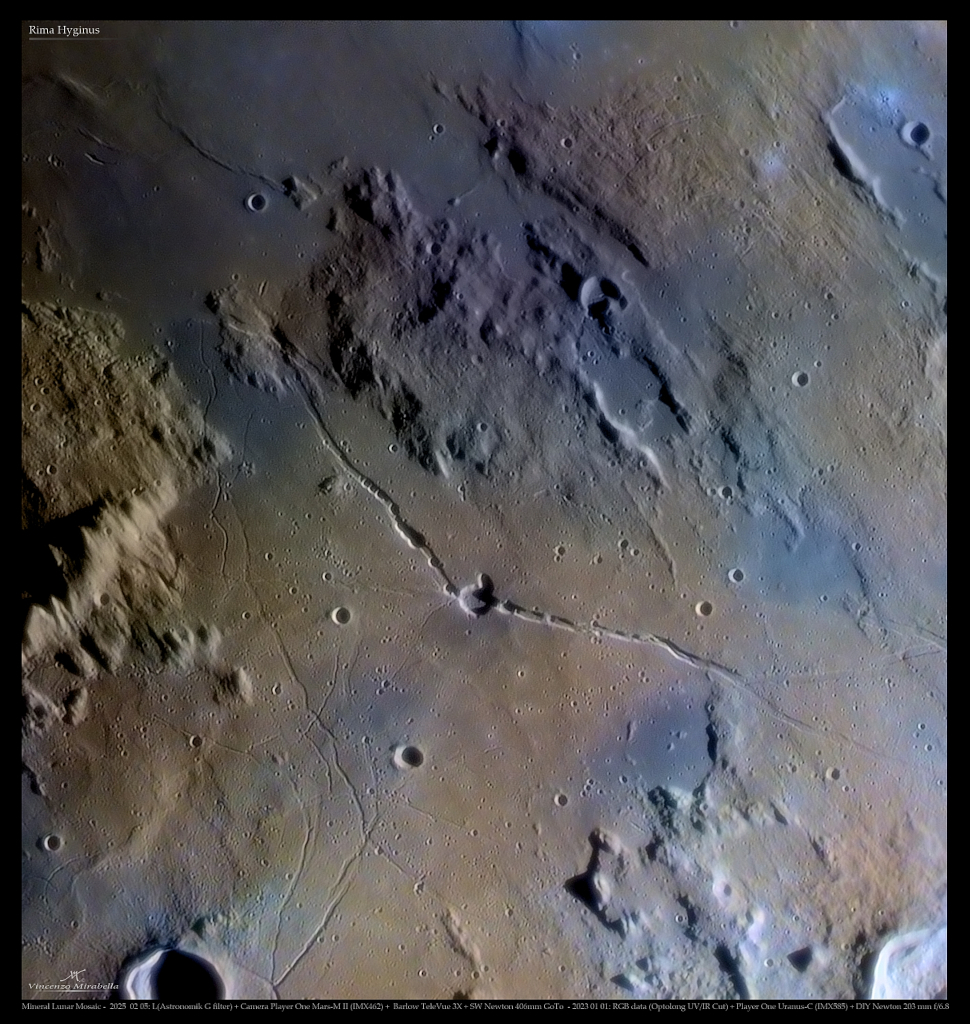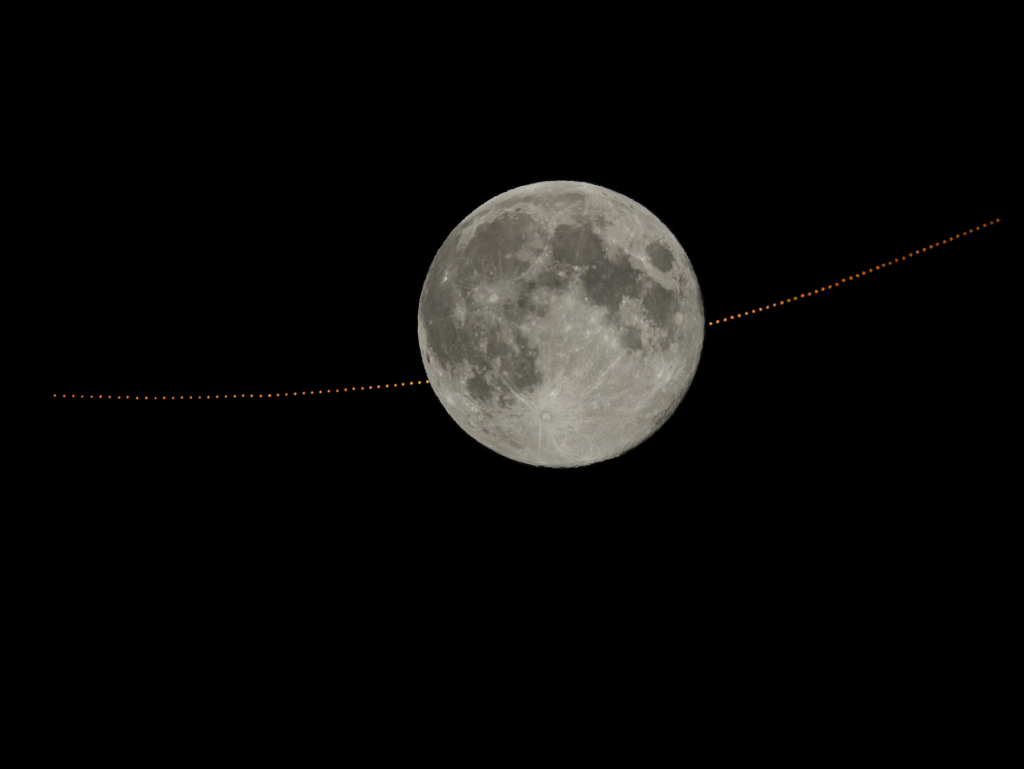Bildcredit: Cassini-Bildgebungsteam, ISS, JPL, ESA, NASA; Stereobild von Roberto Beltramini
Schnappt euch eure 3D-Brille und schwebt neben Helene, dem kleinen Eismond des Saturn!
Helenes Name wurde passend gewählt: Sie ist ein Trojaner-Mond, das bedeutet, sie umkreist einen sogenannten Lagrange-Punkt. Ein Lagrange-Punkt ist eine gravitationsstabile Position in der Nähe zweier massereicher Körper. In diesem Fall sind das Saturn und sein größerer Mond Dione.
Helene ist unregelmäßig geformt (ca. 36 x 32 x 30 Kilometer) und umkreist den führenden Lagrange-Punkt von Dione. Der nach ihrem Bruder benannte Eismond Polydeuces umkreist den nachfolgenden Lagrange-Punkt von Dione.
Das scharfe Stereo-Anaglyphenbild wurde aus zwei Cassini-Bildern erstellt, die bei einem nahen Vorbeiflug im Jahr 2011 aufgenommen wurden. Es zeigt einen Teil der dem Saturn zugewandten Hälfte von Helene, die mit Kratern und rinnenartigen Merkmalen übersät ist.