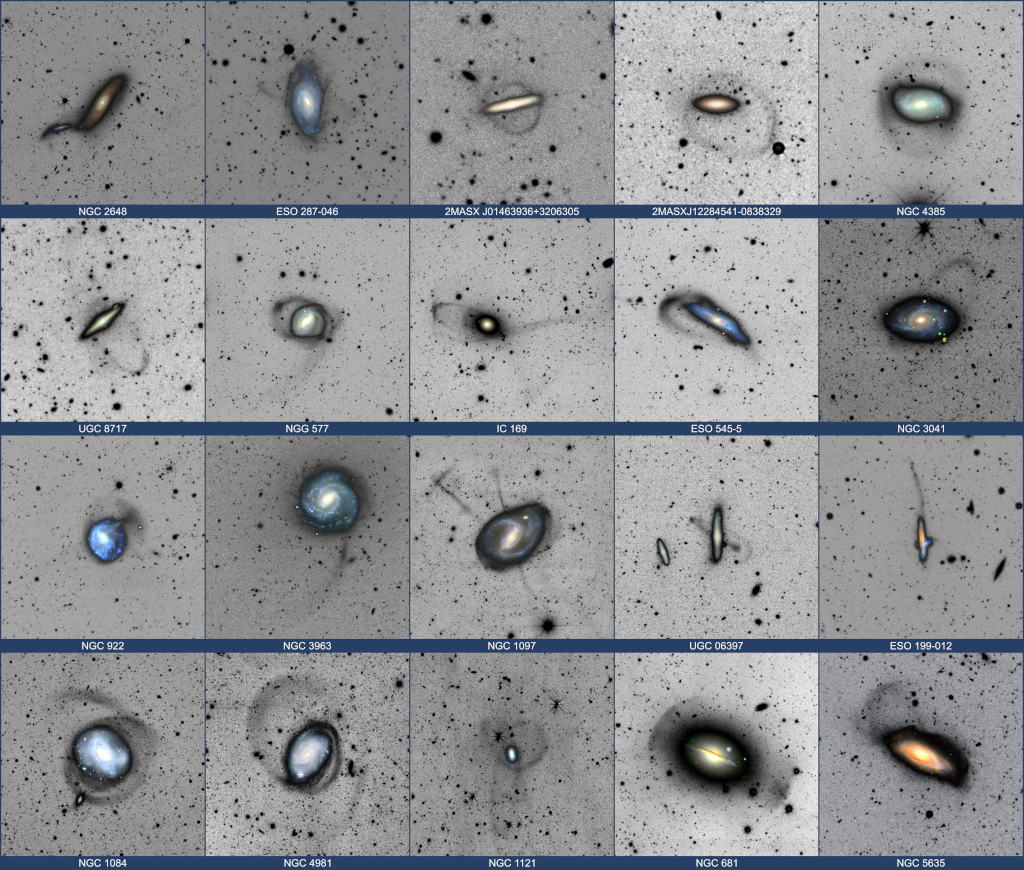Bildcredit und Bildrechte: Xingyang Cai
Diese sechs Tafeln zeigen die täglichen Erscheinungen des Kometen C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, während er sich in der vergangenen Woche von unserem schönen Planeten entfernte. Die Bilder wurden immer mit derselben Kamera und demselben Objektiv aufgenommen. Das jeweilige Datum ist am oberen Bildrand zu finden. Die Aufnahmen fanden alle in Kalifornien statt, teilweise von verschiedenen Standorten.
Ganz rechts ist der Besucher aus der fernen Oortschen Wolke am 12. Oktober zu sehen. Da befand er sich mit einer Entfernung von etwa 70 Millionen Kilometern (ca. 4 Lichtminuten) der Erde am nächsten. Seine helle Koma und sein langer Staubschweif waren am Himmel recht nahe der untergehenden Sonne. Vor dem hellen westlichen Horizont ist der Komet dennoch gut zu erkennen.
In den folgenden Tagen steigt der Komet stetig über die Ekliptik und nach Norden in den dunkleren westlichen Abendhimmel auf. Dabei entfernt er sich immer weiter von der Erde und verschwindet allmählich aus dem Blickfeld.
Beim Durchqueren der Erdbahnebene um den 14. Oktober zeigt Tsuchinshan-ATLAS einen auffälligen, zum Westhorizont hin verlängerten Gegenschweif. Bei Sonnenuntergang am 17. Oktober (ganz links) ist der Komet bereits verblasst und hat eine Entfernung von etwa 77 Millionen Kilometern zur Erde erreicht.
Ich hoffe, Sie hatten Glück mit dem Wetter und konnten Tsuchinshan-ATLAS ebenfalls beobachten. Schließlich bemühte er sich, der beste Komet des Jahres 2024 zu werden. Ursprünglich wurde die Umlaufzeit dieses Kometen auf nur 80.000 Jahre geschätzt, aber in Wirklichkeit kehrt er vielleicht nie in das innere Sonnensystem zurück.
Galerie: Komet Tsuchinshan-ATLAS 2024