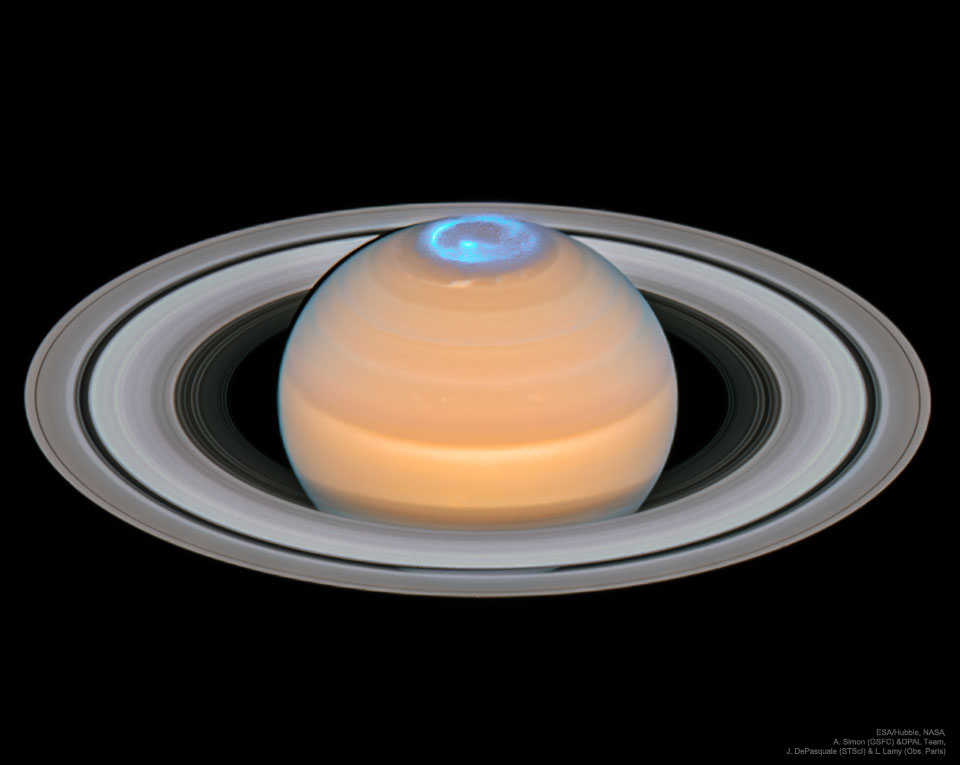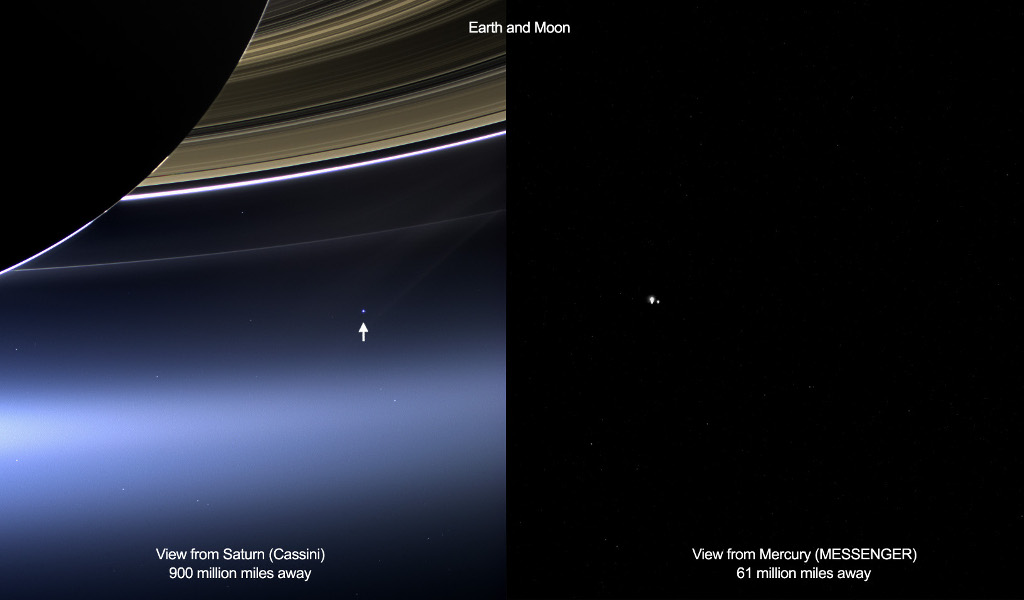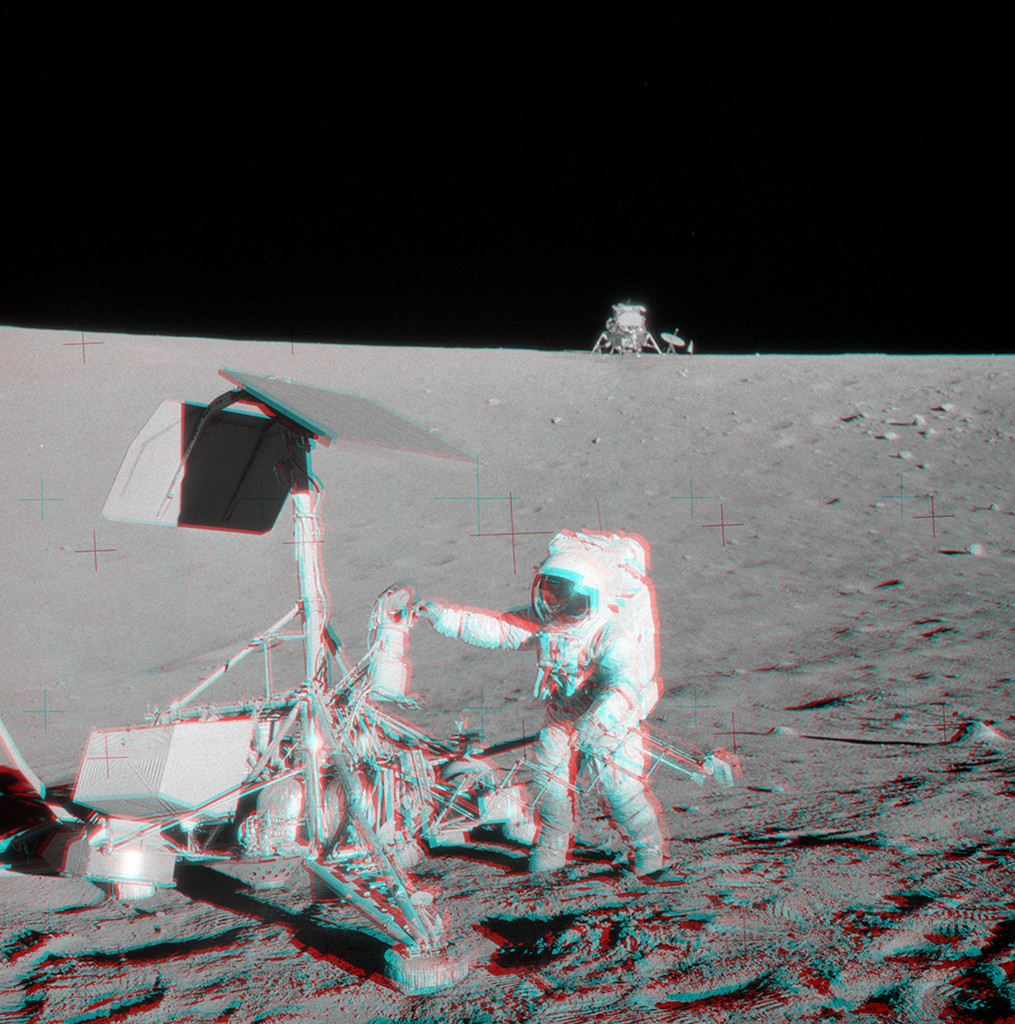Bildcredit und Bildrechte: Kristina Makeeva
Was sind diese im Baikalsee eingefrorenen Blasen? Methan. Der Baikalsee, ein UNESCO–Weltnaturerbe in Russland, ist der größte (nach Volumen) älteste und tiefste See der Welt und enthält über 20 Prozent des Süßwassers der Welt. Der See ist auch ein riesiger Speicher für Methan. Dieses Treibhausgas könnte, wenn es freigesetzt wird, die Menge des von der Erdatmosphäre absorbierten Infrarotlichts und damit die Durchschnittstemperatur des gesamten Planeten erhöhen.
Glücklicherweise ist die Menge an Methan, die derzeit ausströmt, klimatisch nicht von Bedeutung. Es ist jedoch nicht klar, was passieren würde, wenn die Temperaturen in der Region deutlich ansteigen oder der Wasserspiegel des Baikalsees sinken würde. Auf dem Bild sind die Blasen des aufsteigenden Methans im Winter in das außergewöhnlich klare Eis des Sees eingefroren.
Knobelspiel: Astronomie-Puzzle des Tages