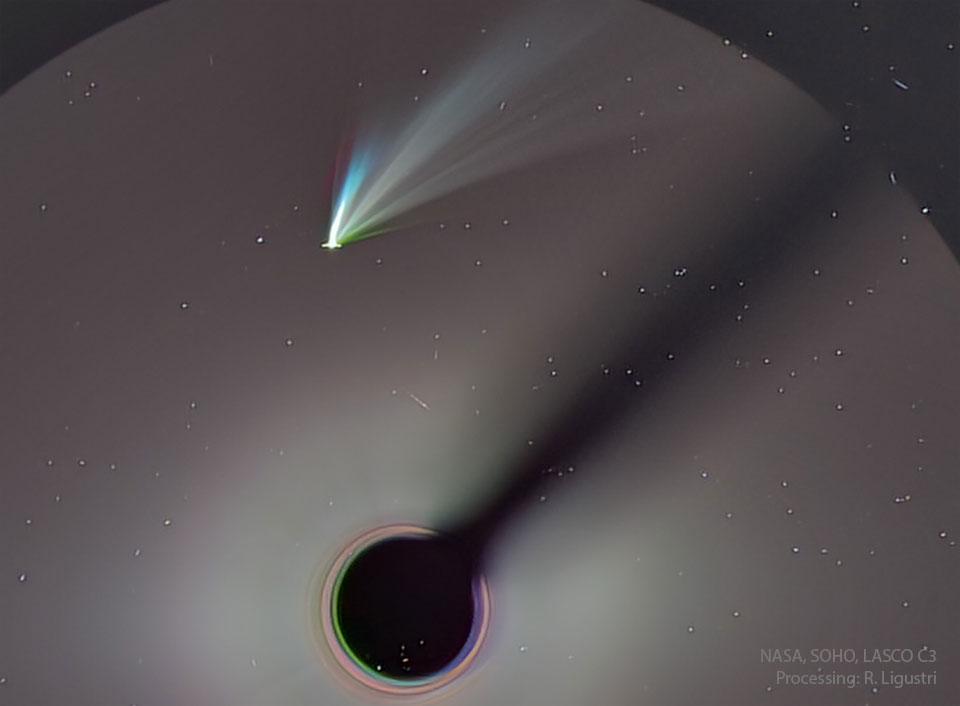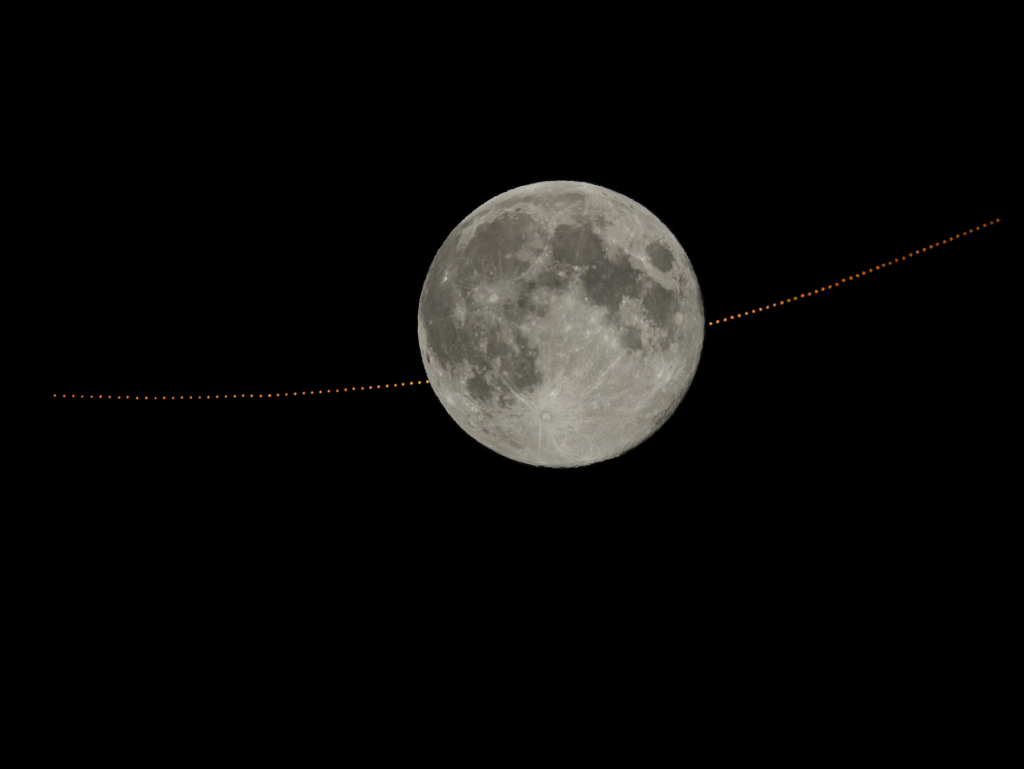Bildcredit und Bildrechte: Mike Selby
Richten Sie Ihr Teleskop auf das hoch am Himmel stehende Sternbild Pegasus, und Sie können diese kosmische Weite von Sternen der Milchstraßen und entfernten Galaxien entdecken.
NGC 7814 befindet sich in der Mitte dieses scharfen Bildes, das fast so groß wie ein Vollmond ist. NGC 7814 wird wegen ihrer Ähnlichkeit mit der helleren und berühmteren M104, der Sombrerogalaxie, manchmal auch kleine Sombrerogalaxie genannt.
Sowohl Sombrerogalaxie als auch die kleine Sombrerogalaxie sind Spiralgalaxien. Sie haben ausgedehnte Halos und zentrale Ausbuchtungen, wenn man sie von der Seite betrachtet. Diese Halos werden dabei von einer dünnen Scheibe mit noch dünneren Staubspuren in der Silhouette durchschnitten.
NGC 7814 ist etwa 40 Millionen Lichtjahre entfernt und hat einen geschätzten Durchmesser von 60.000 Lichtjahren. Damit hat die kleine Sombrerogalaxie in etwa die gleiche Größe wie ihr bekannterer Namensvetter und erscheint nur deshalb kleiner und schwächer, weil sie weiter entfernt ist.